
Tabula Peutingeriana – Single display of hits
| Toponym TP (renewed): | Benebento |
| Name (modern): | Benevento |
| Image: | 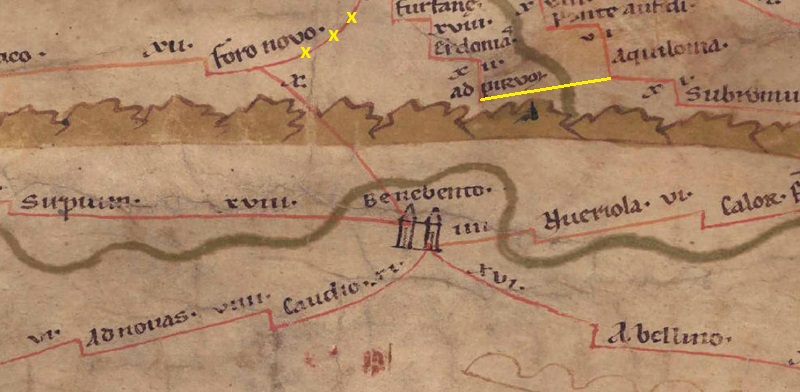 To the image detail |
| Toponym before | X Foro Novo XVIII Sirpium XI Caudio |
| Toponym following | IIII Nueriola XVI Abellino |
| Alternative Image |
|
| Image (Barrington 2000) |
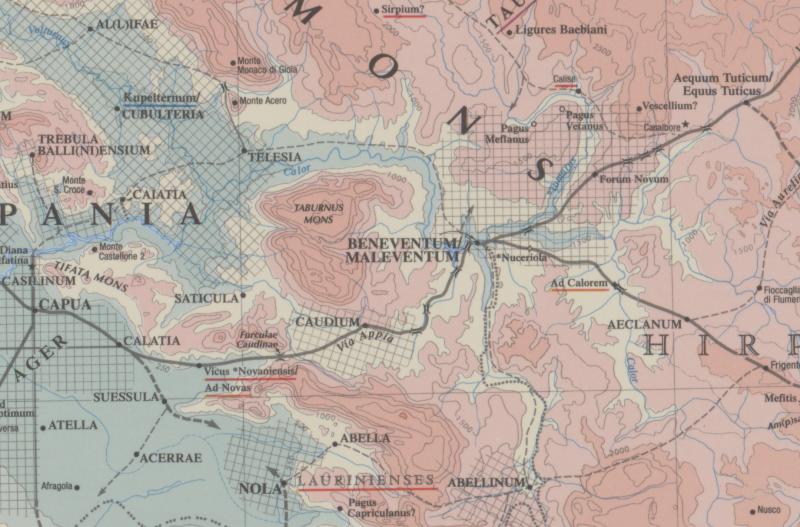 |
| Image (Scheyb 1753) | --- |
| Image (Welser 1598) | --- |
| Image (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/432721 |
| Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Benevento |
| Area: | Italy |
| Toponym Type: | Toponym with Symbol |
| Grid square: | 5B4 / 5B5 |
| Toponym Color: | black |
| Vignette Type : | A Twin Towers |
| Itinerary: | Benevento (111,6; 112,1; 120,1; 121,8; 122,3; 302,2; 304,4; 304,6; 305,5), civitas Benevento (610,11) |
| Alternative Name (Lexica): | Beneventum (DNP) |
| Name A (RE): | Beneventum [2] - https://elexikon.ch/RE/III,1_273.png, - https://elexikon.ch/RE/SI_249.png |
| Name B (Barrington Atlas): | Beneventum/Maleventum (44 G3) |
| Name C (TIR/TIB/others): |
|
| Name D (Miller): | Benebento |
| Name E (Levi): | Benebento (A,I,2) |
| Name F (Ravennate): | Beneventus (p. 72.06), Beneventane (p. 72.45) |
| Name G (Ptolemy): | Βενεουέντον (3,1,67; 8,8,6) |
| Plinius: | Hirpinorum colonia una Beneventum, quondam Malleventum (3,105) |
| Strabo: | Βενεουέντον (5,4,10; 5,4,11; 6,3,7) |
| Dating from Toponym on TP: | Late Hellenism (after 200 BC) |
| Argument for Dating: | Erste überlieferte literarische Erwähnung bei Polybios. |
| Commentary on the Toponym: |
Kommentar (Köhner) |
| References: |
[1] Buonocore, Marco, Beneventum, in: DNP 2 (1997), Sp. 563. |
| Last Update: | 22.11.2025 23:05 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_en.php?id=374 [last accessed on November 24, 2025]