
Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige
| Toponym TP (aufgelöst): | Fluvius Afesia |
| Name (modern): | Adige/Etsch |
| Bild: | 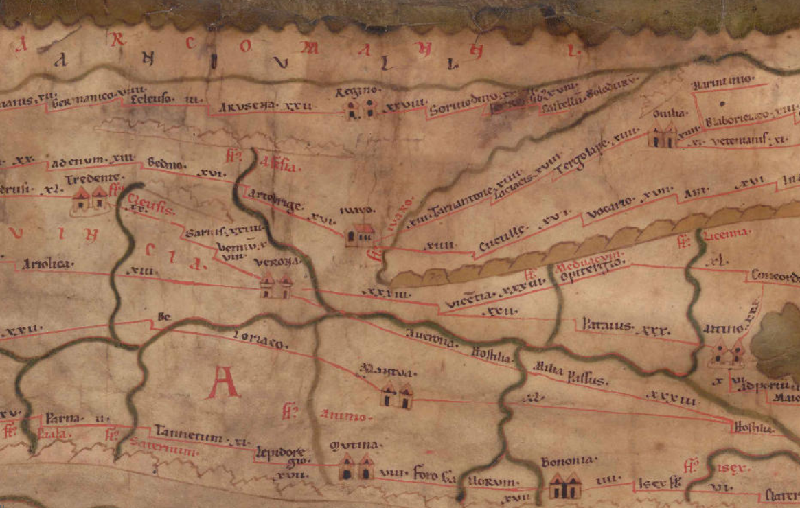 Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |
| Toponym vorher | |
| Toponym nachher | |
| Alternatives Bild | --- |
| Bild (Barrington 2000) |
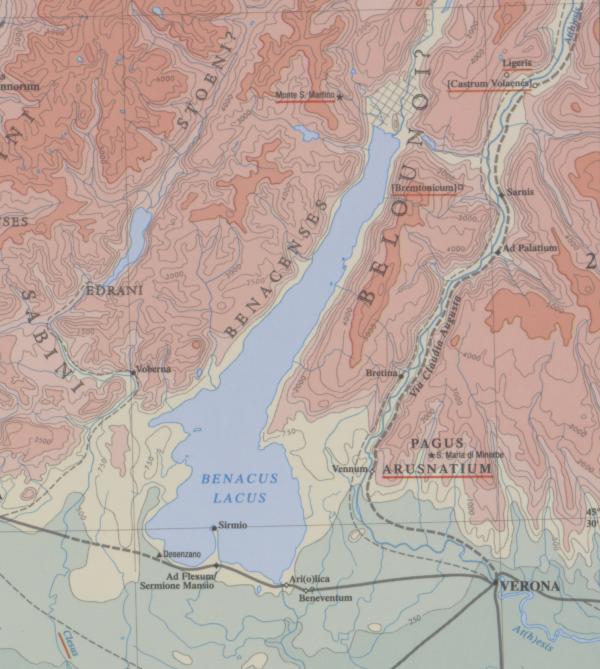 |
| Bild (Scheyb 1753) | --- |
| Bild (Welser 1598) | --- |
| Bild (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/393383 |
| Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Etsch |
| Großraum: | Italien |
| Toponym Typus: | Fluss |
| Planquadrat: | 3A3 |
| Farbe des Toponyms: | rot |
| Vignette Typus : | --- |
| Itinerar (ed. Cuntz): |
|
| Inschriften (EDCS-ID): | |
| Alternativer Name (Lexika): | Atesis (DNP) |
| RE: | Atesis - https://elexikon.ch/RE/II,2_1925.png |
| Barrington Atlas: | At(h)esis fl. (40 A1 / 39 I3) |
| TIR / TIB /sonstiges: | Athesis fl. (TIR L 33, 26) |
| Miller: | Fl` Afesia |
| Levi: |
|
| Ravennat: |
|
| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): |
|
| Plinius: | Atesis (3,121) |
| Strabo: | Ἀτησῖνος (4,6,9) |
| Autor (Hellenismus / Späte Republik): |
|
| Datierung des Toponyms auf der TP: | --- |
| Begründung zur Datierung: |
|
| Kommentar zum Toponym: |
Miller, Itineraria, Sp. 388: Fl` Afesia (irrig Atesia und Afefia (Bt, Bg)), Athesis (Verg, Sil, Claud, Flor, Pl), Ἀτησινὸς (St), Ἀτισών (Plut); entspringt auf den Rätischen Alpen, der Hauptfluß von Rätia I, ergießt sich in mehreren Mündungen ins Adriatische Meer. Auf der Karte ist er ein linker Nebenfluß des Padus; j. Adige oder Etsch. |
| Literatur: |
[1] Bosio/Rosada, Fonti II, S. 81. |
| Letzte Bearbeitung: | 18.11.2025 18:58 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/einzelanzeige.php?id=2532 [zuletzt aufgerufen am 02.01.2026]