
Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige
| Toponym TP (aufgelöst): | Gennaua (Gennava) |
| Name (modern): | Genf/Geneva/Genève |
| Bild: | 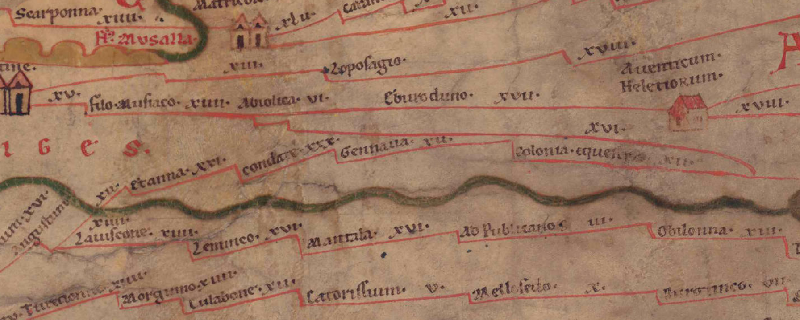 Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |
| Toponym vorher | XXX Condate |
| Toponym nachher | XII Colonia equestris |
| Alternatives Bild | --- |
| Bild (Barrington 2000) |
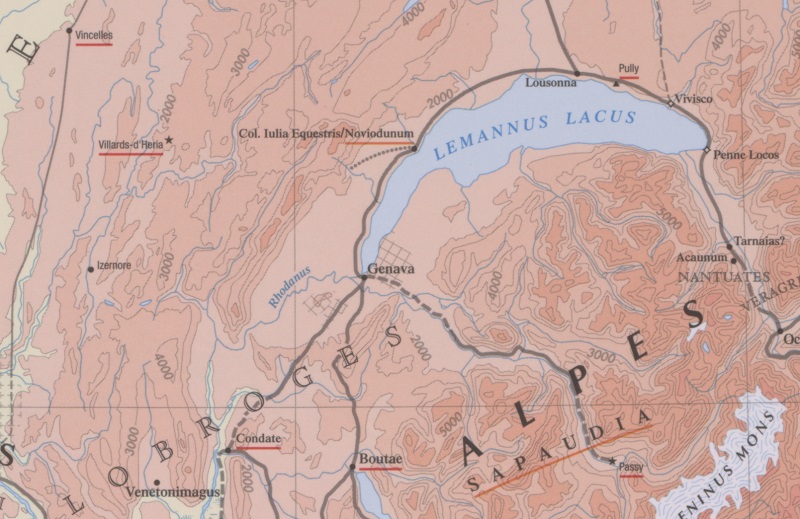 |
| Bild (Scheyb 1753) | --- |
| Bild (Welser 1598) | --- |
| Bild (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/177528 |
| Großraum: | Gallien/Germanien |
| Toponym Typus: | Ortsname ohne Symbol |
| Planquadrat: | 2B1 |
| Farbe des Toponyms: | schwarz |
| Vignette Typus : | --- |
| Itinerar (ed. Cuntz): | Genava (347,12) |
| Alternativer Name (Lexika): | Genava (DNP) |
| RE: | Genava [1] - https://elexikon.ch/RE/VII,1_1129.png |
| Barrington Atlas: | Genava (18 D3) |
| TIR / TIB /sonstiges: |
|
| Miller: | Gennaua |
| Levi: |
|
| Ravennat: | Genua (p. 63.16; 63.19; 63.38) |
| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): |
|
| Plinius: |
|
| Strabo: |
|
| Autor (Hellenismus / Späte Republik): |
|
| Datierung des Toponyms auf der TP: | --- |
| Begründung zur Datierung: |
|
| Kommentar zum Toponym: |
Miller, Itineraria, Sp. 124: |
| Literatur: |
1 Desjardins, Table, p. 55, col. 3, no. 5 - p. 56, col. 1. |
| Letzte Bearbeitung: | 08.01.2026 14:08 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige.php?id=3412 [zuletzt aufgerufen am 01.03.2026]