
Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige
| Toponym TP (aufgelöst): | Cabios |
| Name (modern): | Castiglione |
| Bild: | 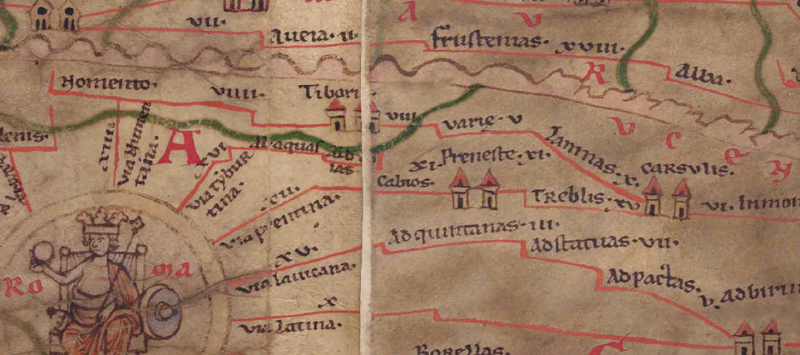 Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |
| Toponym vorher | XII Via Prentina (Via Praenestina) |
| Toponym nachher | XI Preneste |
| Alternatives Bild | --- |
| Bild (Barrington 2000) |
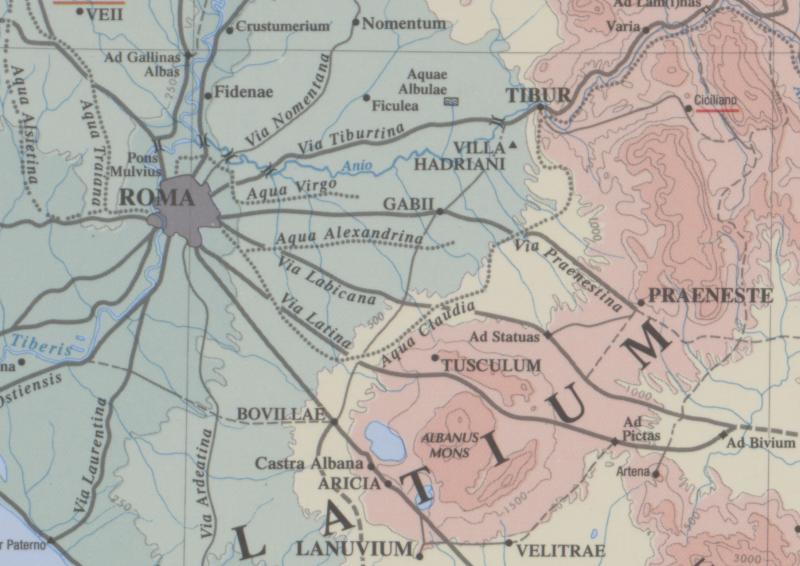 |
| Bild (Scheyb 1753) | --- |
| Bild (Welser 1598) | --- |
| Bild (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/422932 |
| Großraum: | Italien |
| Toponym Typus: | Ortsname ohne Symbol |
| Planquadrat: | 5B1 |
| Farbe des Toponyms: | schwarz |
| Vignette Typus : | --- |
| Itinerar (ed. Cuntz): | Gabios (302,3) |
| Alternativer Name (Lexika): | Gabii (DNP) |
| RE: | Gabii |
| Barrington Atlas: | Gabii (43 C2 / 44 C2) |
| TIR / TIB /sonstiges: |
|
| Miller: | Cabios |
| Levi: |
|
| Ravennat: | Gabio (p. 71.34), Gabios (p. 71.36) |
| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): |
|
| Plinius: |
|
| Strabo: | Γάβιοι (5,3,10; 5,3,11) |
| Autor (Hellenismus / Späte Republik): |
|
| Datierung des Toponyms auf der TP: | --- |
| Begründung zur Datierung: |
|
| Kommentar zum Toponym: |
Kommentar (Talbert): |
| Literatur: |
Desjardins, Table, p. 180, col. 3, no. 1 - p. 181, col. 2. |
| Letzte Bearbeitung: | 05.11.2025 23:45 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige.php?id=341 [zuletzt aufgerufen am 01.03.2026]