
Tabula Peutingeriana – Einzelanzeige
| Toponym TP (aufgelöst): | Literno |
| Name (modern): | bei Lago di Patria |
| Bild: | 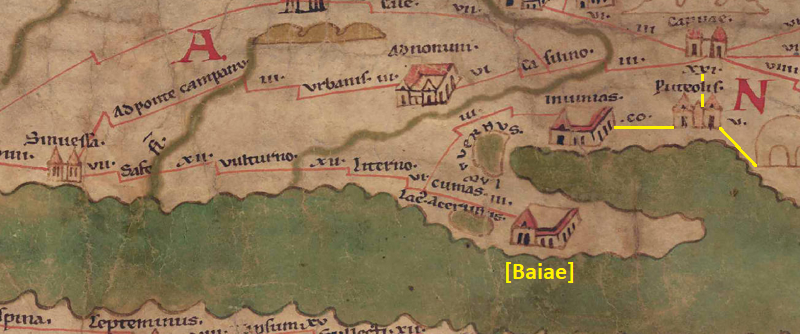 Zum Bildausschnitt auf der gesamten TP |
| Toponym vorher | XII Vulturno |
| Toponym nachher | VI Cumas |
| Alternatives Bild | --- |
| Bild (Barrington 2000) |
 |
| Bild (Scheyb 1753) | --- |
| Bild (Welser 1598) | --- |
| Bild (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/432911 |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Liternum |
| Großraum: | Italien |
| Toponym Typus: | Ortsname ohne Symbol |
| Planquadrat: | 5B3 / 5C3 |
| Farbe des Toponyms: | schwarz |
| Vignette Typus : | --- |
| Itinerar (ed. Cuntz): | Literno (122,6), Litirno (123,4) |
| Alternativer Name (Lexika): | Liternum (DNP) |
| RE: | Liternum - https://elexikon.ch/RE/XIII,1_745 |
| Barrington Atlas: | Liternum (44 F4) |
| TIR / TIB /sonstiges: |
|
| Miller: | Literno |
| Levi: |
|
| Ravennat: | Laternum (p. 69.40), Liternum (p. 85.38) |
| Ptolemaios (ed. Stückelberger / Grasshoff): | Λίτερνον (3,1,6) |
| Plinius: | Liternum (3,61) |
| Strabo: | Λιτέρνον (5,4,4) |
| Autor (Hellenismus / Späte Republik): | in Literninum (Liv. 38,52,1), Vitam Literni (Liv. 38,53,8) = Valerius Antias FRH 15 F 46 = F 45 Peter) |
| Datierung des Toponyms auf der TP: | Römische Republik |
| Begründung zur Datierung: | Erste überlieferte literarische Erwähnung laut Livius bei Valerius Antias und Cicero. |
| Kommentar zum Toponym: |
Kommentar (Köhner) |
| Literatur: |
[1] Bove, Annalisa, Liternum, in: DNP 7 (1999), Sp. 352-353. |
| Letzte Bearbeitung: | 16.12.2025 10:24 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige.php?id=511 [zuletzt aufgerufen am 31.12.2025]